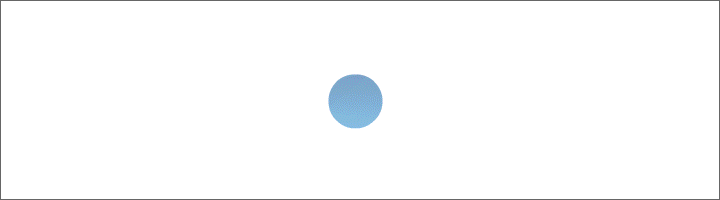1. Der Fall - Gerald Eugene Stano
Gerald Eugene Stano (* 12. September 1951 in Schenectady, New York; † 23. März 1998 in Starke, Florida) war ein US-amerikanischer Serienmörder, der gestand 41 Frauen in New Jersey, Pennsylvania und Florida ermordet zu haben.

 Am 25. März 1980 kam eine Prostituierte in die Polizeistation von Daytona Beach und sagte aus, dass sie von einem Mann attackiert wurde. Sie konnte jedoch entkommen und sich das Nummernschild des Wagens merken. Die Polizei identifizierte den Inhaber als den 28-jährigen Gerald Eugene Stano aus Ormond Beach. Bei der Befragung am 1. April 1980 gestand er den Angriff auf die Frau. Als ihn die Polizei verdächtigte auch für weitere Angriffe auf Frauen verantwortlich zu sein und ihm Fotos von vermissten und bereits ermordeten Frauen zeigte, verstrickte er sich in Widersprüche und gab im Laufe des Verhöres sowie weiterer Befragungen schließlich zu, 41 Frauen zwischen 1974 und 1980 ermordet zu haben.
Am 25. März 1980 kam eine Prostituierte in die Polizeistation von Daytona Beach und sagte aus, dass sie von einem Mann attackiert wurde. Sie konnte jedoch entkommen und sich das Nummernschild des Wagens merken. Die Polizei identifizierte den Inhaber als den 28-jährigen Gerald Eugene Stano aus Ormond Beach. Bei der Befragung am 1. April 1980 gestand er den Angriff auf die Frau. Als ihn die Polizei verdächtigte auch für weitere Angriffe auf Frauen verantwortlich zu sein und ihm Fotos von vermissten und bereits ermordeten Frauen zeigte, verstrickte er sich in Widersprüche und gab im Laufe des Verhöres sowie weiterer Befragungen schließlich zu, 41 Frauen zwischen 1974 und 1980 ermordet zu haben.

Stano ....und das Ende.
Da viele seiner Geständnisse nicht zur Anklage gebracht wurden und 19 Opfer gar nicht mehr identifiziert werden konnten, wurde er für lediglich 9 der Morde für schuldig befunden und am 23. März 1998 im Florida State Prison auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.
Quellen: Blind Fury von Anna Flowers ISBN 1-55817-719-1
2. Der Fall - Stephen Dennison
Stephen Dennison aus Salem im Bundesstaat New York lechzte nach einer Zigarette, und außerdem hatte er Hunger. Da der Kiosk geschlossen war, entschloss er sich, auf die Rückkehr des Standinhabers zu warten. Doch dann gewann seine Gier nach Nikotin die Oberhand: Er zog sein Klappmesser heraus, schlitzte die Leinwand an einer Seite des Kiosks auf und stieg ein. Dort nahm er eine Stange Zigaretten, Pfefferminzbonbons, ein paar Schokoladenriegel und eine silberfarbene Puderdose für seine Mutter an sich. Gerade als er sich eine Zigarette anzünden wollte, kehrte die Besitzerin zurück und erwischte ihn mit ihrer Puderdose und der Beute im Wert von fünf Dollar.
Da der 16 Jahre alte Dennison zum ersten Mal straffällig geworden setzte der Richter die zehnjährige Haftstrafe in der Besserungsanstalt Jllmira unter der Bedingung aus, dass er sich eine Arbeit suche und sich einmal im Monat mit dem methodistischen Pfarrer, Reverend Winch, treffe. Die ersten drei Monate lief alles wunderbar. Dennison konnte jedoch von den Zigaretten nicht ablassen und verlor seine Arbeit, weil er in der Männertoilette geraucht hatte. Vor lauter Scham ließ er die Treffen bei Reverend Winch ausfallen und wurde wegen Verletzung der Bewährungsauflagen erneut vor Gericht gestellt.
Der Richter schickte Dennison als Rückfalltäter auf unbestimmte Zeit in die Elmira-Besserungsanstalt. Durch Zufall wurde die früher auferlegte Strafe von zehn Jahren in den Akten vermerkt, die 1926 mit Dennison nach Elmira gesandt wurden. In Elmira durfte nicht geraucht werden. Als ein anderer Insasse Dennison erzählte, dass das Rauchen im Dannemora State Hospital erlaubt sei, simulierte Dennison einen Anfall von Wahnsinn. So wurde er von Elmira nach Dannemora verlegt um seine Strafe auf der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses abzusitzen.
Dennison hatte seine zehnjährige Strafe bis auf einen Tag abgebüßt, als die Verantwortlichen in Dannemora bei Gericht die ständige Verwahrung des Patienten mit der Begründung beantragten, er sei wahnsinnig. Als ein Richter acht Tage später dem Antrag stattgab, hatte Dennison seine Strafe eigentlich abgebüßt und hätte entlassen werden müssen. Weder er noch seine Familie wurden von dem Antrag auf ständige Verwahrung in Kenntnis gesetzt, und es gab niemanden, der sich für ihn verwendet hätte. Dennisons Mutter, die einzige, die ihn je besucht hatte, war einige Jahre vorher gestorben. Dennison sollte noch weitere 25 Jahre in der psychiatrischen Abteilung verbringen.
Der Justizirrtum kam ans Licht als George, ein Halbbruder Dennisons, ihm schließlich einen Besuch in Dannemora abstattete. Ein Onkel hatte Stephen 1300 Dollar vermacht, und George wollte seinem Bruder diese Nachricht persönlich überbringen, auch wenn der Krankenhausvorstand behauptete, Stephen sei so krank, dass er seine Angehörigen nicht erkennen würde. Doch Stephen schien bei klarem Verstand zu sein.
Und nachdem er George erzählt hatte, er sei misshandelt worden und habe lange Zeit in Einzelhaft verbringen müssen, beauftragte George einen Anwalt, den Fall zu untersuchen.
Weil Stephen ohne Anhörung oder juristische Vertretung nach Dannemora eingewiesen worden war, erreichte sein Rechtsanwalt eine Freilassung durch gerichtliche Anordnung eines Haftprüfungstermins. Nach 24 Jahren unrechtmäßiger Freiheitsberaubung wurde Dennison entlassen.
Dennison sollte 115 000 Dollar Wiedergutmachung vom Staat New York erhalten, doch das Urteil wurde von einem höheren Gericht aufgehoben. Um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, nahm er einen Posten als Hausmeister an. 1991 starb er in Armut aber als freier Mann.
Quellen: Die Welt des Verbrechens (von Naumann & Göbel) S. 131 - ISBN 3-625-10644-2
3. Der Fall - Donato Bilancia
 Im Intercity »Tigullio« von La Spezia nach Venedig waren am Nachmittag des Ostersonntags, des 12. April 1998, nur wenige Passagiere unterwegs. Wohl auch deswegen fiel einem der Zugbegleiter auf, dass der Waschraum des Erste-Klasse-Waggons 630 schon seit unüblich langer Zeit, mindestens seit Genua, besetzt war. Bei seinem Kontrollgang nach dem Verlassen des Mailänder Hauptbahnhofs um 17 Uhr 05 bemerkte er außerdem, dass in einem ansonsten leeren Abteil in der Nähe des immer noch besetzten Waschraums eine Reisetasche und eine Damengeldbörse lagen.
Im Intercity »Tigullio« von La Spezia nach Venedig waren am Nachmittag des Ostersonntags, des 12. April 1998, nur wenige Passagiere unterwegs. Wohl auch deswegen fiel einem der Zugbegleiter auf, dass der Waschraum des Erste-Klasse-Waggons 630 schon seit unüblich langer Zeit, mindestens seit Genua, besetzt war. Bei seinem Kontrollgang nach dem Verlassen des Mailänder Hauptbahnhofs um 17 Uhr 05 bemerkte er außerdem, dass in einem ansonsten leeren Abteil in der Nähe des immer noch besetzten Waschraums eine Reisetasche und eine Damengeldbörse lagen.
War etwa einer Reisenden schlecht geworden, brauchte sie Hilfe? Nach kurzem Zuwarten klopfte er an die von innen versperrte Tür. Keine Antwort. Als er auch auf wiederholtes Klopfen und Fragen keine Reaktion erhielt, öffnete er mit einem Nachschlüssel. Vor ihm, auf dem Boden des Waschraums, lag eine junge Frau auf den Knien, den Kopf in die Ecke gebeugt. Als sich der Beamte hinunterbeugte, um ihr seine Hilfe anzubieten, musste er entsetzt festellen, dass dies nicht mehr möglich war. Der Kopf, von halblangen brünetten Haaren bedeckt, war eine einzige blutige Masse.
Er alarmierte den Zugführer, der sofort die Bahnpolizei verständigte. Im Bahnhof von Verona wurde der Waggon mit der Toten abgekoppelt. Um Aufsehen zu vermeiden, ersuchte man die wenigen Reisenden, in einen anderen Zug umzusteigen. Die Beamten von der »Polfer« (für »polizia ferroviale«) begannen mit ihren Untersuchungen. Die Identität des Opfers ergab sich aus den Papieren in ihrer Handtasche. Die Frau hieß Elisabetta Zoppetti, hätte in vierzehn Tagen ihren 33. Geburtstag gefeiert, war verheiratet und arbeitete als Krankenschwester im Krebsinstitut in Mailand. Das Foto eines kleinen Mädchens, offenbarihrer Tochter, steckte in ihrem Portemonnaie. Ihrer Fahrkarte zufolge war sie in Chiavari an der Riviera, westlich von Genua, zugestiegen und hatte bis Mailand fahren wollen.
Die erste medizinische Untersuchung des Opfers ergab einen seltsamen Befund: Signora Zoppetti war in kniender Stellung durch einen im Nacken angesetzten Schuss aus einer Handfeuerwaffe getötet worden, wie starke Schmauchspuren an der Einschusswunde bewiesen. Eine Jacke und ein Pullover der Toten, die neben der Leiche lagen, wiesen ebenfalls starke Schmauchspuren auf. Der Täter hatte sie offenbar benutzt, um das laute Schussgeräusch zu dämpfen. Der tödliche Schuss war zweifellos erst im Waschraum abgegeben worden; Projektil fand sich allerdings keines. Die Leiche wies keine zusätzlichen Verletzungen - etwa Abwehrwunden an Händen oder im Gesicht - auf.
Der Täter hatte sein Opfer offensichtlich genötigt, vor ihm aus dem Abteil in den Waschraum zu gehen, es dort in die Knie gezwungen und dann von hinten überraschend erschossen. Daraufhin hatte er allem Anschein nach mit einem Nachschlüssel die Türe von außen versperrt. Dass er nicht im Waschraum gelauert hatte, war offensichtlich; Elisabetta hätte sonst sicher nicht ihre Handtasche im Abteil liegen gelassen. Tötung durch Genickschuss also, wie bei einer Hinrichtung - aber wer sollte eine junge Frau auf derart brutale Weise hinrichten und warum?
Die Einvernahme des völlig verzweifelten Ehemannes der Ermordeten brachte keine Hinweise auf ein mögliches Motiv. Er hatte mit seiner Frau und seiner Tochter Kurzferien an der Riviera gemacht; Elisabetta aber musste früher nach Mailand zurück, da sie von Sonntag auf Montag Nachtdienst hatte. Ehemann und Tochter hatten sie zum Zug begleitet. Sie hatten noch eine Fahrkarte erster Klasse gekauft, da sie angenommen hatten, der Zug würde wegen der Feiertage besonders frequentiert sein. Das war jedoch nicht der Fall gewesen: Signora Zoppetti hatte seit der Abfahrt in Chiavari allein im Abteil gesessen. Einen Grund für die Tat, beispielsweise irgendeine Verwicklung in Unterweltgeschäfte, wies der Ehemann glaubwürdig und entrüstet zurück.
Von den Mitreisenden, die zum großen Teil erst ausgeforscht werden mussten, da man sie dummerweise weiterfahren hatte lassen, hatte keiner den Schuss gehört oder gesehen, wie die junge Frau aus ihrem Abteil zum Waschraum entführt worden war. Immerhin meldete sich ein Zeuge, dem ein Mann aufgefallen war, der ebenfalls in Chiavari zugestiegen war und den zärtlichen Abschied des Ehepaares am Bahnhof auffallend eindringlich beobachtet hatte. Es habe sich um einen Menschen von »nicht sehr empfehlenswertem Äußerem« (»poco raccommanda-bile«), mit »besonders verkniffenen, wütenden« Gesichtszügen gehandelt. Nach den Angaben des Zeugen wurde ein Phantombild gezeichnet, mit dessen Hilfe die Polizei weitere Zeugen im Zug oder an den Stationen von Genua bis Verona zu finden hoffte. Irgendwo dazwischen musste der Täter ausgestiegen sein und vielleicht war er ja dabei doch jemandem aufgefallen.
Die Obduktion der Toten im gerichtsmedizinischen Institut von Verona bestätigte den ersten Befund: Signora Zoppetti war in kniender Stellung im Waschraum durch einen angesetzten Schuss in den Nacken getötet worden. Eigenartig war die Munition, die aus einer großkalibrigen Waffe, wahrscheinlich Kaliber .38, stammen musste: ein Bleigeschoss ohne Mantel, das beim Auftreffen auf härtere Substanzen, z. B. Knochen, ähnlich einem Dumdum-Geschoss sofort in Hunderte kleine Partikel zersplittert und bei einem relativ kleinen Einschussloch riesige Ausschusswunden verursacht. Solche Geschosse werden normalerweise bei Schießwettbewerben und Preisschießen verwendet, da sie in der Zielscheibe aus Papier ein exaktes, rundes Einschussloch hinterlassen; sie sind unter dem Namen »Wadecutter« im Handel. Da nach dem Schuss kein Projektil zurückbleibt, kann der Typus der. verwendeten Waffe bei Untersuchungen nicht bestimmt werden, ebenso wenig wie anhand der Zugspuren die Zuordnung zu einer ganz bestimmten Waffe möglich ist.
Die Verwendung dieser besonders heimtückischen Munition und die ungewöhnliche Inszenierung der Tat rückten die Ermittlungen für die Polizei in ein völlig neues Licht. Seit einigen Monaten terrorisierte ein bisher unbekannter Serienmörder die Riviera zwischen Savona und Genua. Drei junge Frauen waren ihm bisher zum Opfer gefallen, alle auf dieselbe charakteristische Weise getötet, mit einem angesetzten Schuss von hinten; zwei davon ebenfalls in kniender Stellung und alle mit demselben Munitionstyp, wahrscheinlich sogar mit derselben Waffe.
Das erste Opfer war die fünfundzwanzigjährige Albanerin Stela Truya gewesen. Ihre unbekleidete Leiche wurde am 9. März an der Straße zwischen Savona und Genua in Cogoleto gefunden; Todesursache: Genickschuss. Auf dieselbe Weise wurde am 18. März in Pietra Ligure die siebenundzwanzig Jahre alte Ukrainerin Ljudmyla Zuskova getötet; ihr Körper lag nebem dem Eingang zum Friedhof der Stadt. Elf Tage später fiel in Cogoleto die gleichaltrige Evelyn Edsohe aus Nigeria dem Täter zum Opfer.
Ein Unterschied bestand jedoch zwischen dem Mord an Elisabetta Zoppetti und den vorangegangenen Morden, abgesehen vom Tatort: Alle bisherigen Opfer stammten aus den Straßen Genuas. Im Täterprofil hatte die Polizei daher angenommen, es müsse sich um einen Mann handeln, der aus irgendwelchen Gründen Prostituierte hasste - vielleicht war er von ihnen angesteckt oder wegen Impotenz verspottet worden - und der sich mit einem Hinrichtungsfeldzug zu rächen suchte. Verwertbare oder weiterführende Spuren hatte es in keinem einzigen Fall gegeben, der Täter war stets sehr überlegt zu Werke gegangen. Morde an Prostituierten gehören ja an sich zu den am schwierigsten aufzuklärenden Fällen, da die Täter-Opfer-Beziehung fehlt. Hatte der Serienmörder jetzt seinen Rachefeldzug über das Milieu hinaus auf alle Frauen ausgedehnt und sich als Tatort die Eisenbahn ausgesucht?
Der Verdacht, es könne sich um ein und denselben Täter handeln, wurde zur drohenden Gewissheit, als nur zwei Tage nach dem Mord im Zug, am 14. April, die Leiche der mazedonischen Prostituierten Kristina Kvalla gefunden wurde, wieder in Pietra Ligure, wieder die gleiche grausame Tötungsart: Genickschuss von hinten auf das zum Knien gezwungene Opfer. Die Zeit zwischen den Morden des Riviera-Monsters wurde offenbar immer kürzer - nach den Erkenntnissen des FBI typisch für einen Serienmörder, der sich sicher fühlt. Die sich beschleunigende Frequenz setzte die Polizei, die kaum Spuren hatte, begreiflicherweise unter Druck, auch wenn man den Mord zunächst nicht bekannt gab.
Alle ermittelnden Polizeidienststellen - sowohl die, die den Mord an Elisabetta Zoppetti im Intercity untersuchten, als auch jene, die sich bisher mit dem Serienmörder befasst hatten - wurden zu einer »Task-Force« zusammengefasst. Die Fahndungen konzentrierten sich auf die Personenbeschreibung, das »Identikit«, das aufgrund der Zeugenbeschreibung im Zug erstellt worden war. Es konnte durch Angaben eines Bahnbediensteten wesentlich ergänzt werden, dem der finster blickende Typ im Zug ebenfalls aufgefallen war. Er beschrieb ihn als etwa vierzigjährigen, leicht verwahrlost wirkenden Mann mit olivfarbigem Teint und dunklem Haar. Auch hatte er bemerkt, wie hasserfüllt der Verdächtige den Abschied des Ehepaares Zoppetti am Bahnhof Chiavari beobachtet hatte.
Von der Task-Force wurde ein weiterer, bisher nicht aufgeklärter Mordfall in die Ermittlungen aufgenommen, der nach dem damaligen Untersuchungsstand ebenfalls in das Schema der bisherigen Verbrechen passte und bei dem dieselbe Munition verwendet worden war. Am 23. März war in Nova Ligure der Transsexuelle Julio Castro, genannt Lorena, ein Venezueler, von einem Mann in einem schwarzen Mercedes angesprochen und dann auf freiem Feld mit einer Pistole niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Auf seine Hilferufe kamen zwei Nachtwächter, Candido Randö und Massimo Gualillo, die ihre Hilfsbereitschaft mit dem Leben bezahlten. Beide wurden von dem Mann im Mercedes erschossen, mit derselben Munition wie die Prostituierten, nämlich mantellosen Bleigeschossen aus einer großkalibrigen Feuerwaffe. Castro, den der Täter wahrscheinlich für tot gehalten hatte, überlebte den Angriff. Offenbar hatte sich der Täter in der Person des gut gekleideten und geschminkten Transsexuellen geirrt und ihn für das gehalten, was er zu sein vorgab. Die unerwartete männliche Gegenwehr und die Hilferufe hatten die geplante Hinrichtung verhindert. Der Fall - vor allem die Zeugenaussagen Castros - sollte später wesentlich zur Aufklärung der Mordserie beitragen.
Auf jeden Fall aber war zu befürchten, dass der Täter seinen Rachefeldzug keineswegs einstellen würde. Weitere Opfer waren möglich; der Serienmörder schien einen bestimmten zeitlichen Rhythmus einzuhalten: einmal wöchentlich, zu Feiertagen oder am Sonntag. Polizei und Eisenbahnverwaltung dachten noch über Sicherheitsvorkehrungen nach, als sich ihre Befürchtungen schon bewahrheiteten.
Am 18. April, nur sechs Tage nach dem Mord an Elisabetta Zoppetti, kontrollierten zwei Bahnbeamte, Carmelo Matroni und Antonello Nicodemi, gegen halb elf Uhr abends am Bahnhof von Ventimiglia die Wagen des seit einer Stunde abgestellten Regionalzuges Nr. 2888 aus Genua. Die Toilette im Waggon Nr. 4 war von innen verschlossen. Sie holten einen Schlüssel, öffneten die Tür und prallten entsetzt zurück. Eine junge, blonde Frau lag seltsam verkrümmt und vornübergebeugt auf dem Boden; die Wand vor ihr war blutbespritzt, ihre Haare blutgetränkt. Sofort liefen die beiden Bahnbeamten los, um Hilfe zu holen sowie Vorgesetzte und Polizei zu verständigen. Ein Schaffner hatte schon bei der Ankunft des Zuges eine im selben Waggon offenbar vergessene Damentasche abgegeben, die - wie das Foto im Ausweis bestätigte - der Toten gehört hatte. Die verschlossene Toilettentür war ihm nicht aufgefallen.
Das Opfer hieß Maria Angela Rubino, war gleich alt wie Elisabetta Zoppetti, hatte als Hausangestellte bei einer französischen Familie in Mentone gearbeitet und war mit einem Beamten der Grenzpolizei verlobt gewesen; auch sie hatte also eindeutig keine Verbindung zur Unterwelt gehabt. Sie war um 20 Uhr 40 in Albinga in den Zug gestiegen und hatte eine Fahrkarte zweiter Klasse bis Ventimiglia gelöst. Auch das Billett fand sich in ihrer Tasche.
Die Tat glich fast völlig dem Mord im Intercity: der angesetzte Todeschuss von hinten in den Nacken, die kniende Stellung des Opfers, die Jacke, die als Schalldämpfer verwendet worden war, die zurückgelassene Tasche. Auch die Munition war dieselbe, wie die Autopsie ergab. Der Schuss war durch das Genick in den Schädel gegangen und hatte die Kontaktlinsen des Opfers herausgeschleudert. Ein paar Bleipartikel des Geschosses steckten noch im Boden der Toilette. Ohne Frage steckte derselbe Täter hinter dem Blutverbrechen.
Dass sich nach Bekanntwerden des zweiten Mordes in einem Zug innerhalb kürzester Zeit Panik in der Bevölkerung breit zu machen begann, versteht sich fast von selbst. Die Bahndirektion und das Innenministerium suchten zu beruhigen, widersprachen aber heftig, als der Gouverneur von Genua seinen Mitbürgern nahe legte, Bahnfahrten in Zukunft besser überhaupt zu unterlassen oder nur in dringenden Notfällen zu unternehmen. Der Tourismusdirektor der Region befürchtete Schäden für den Fremdenverkehr, da der Fall auch international bekannt geworden war.
Besonders für den 25. April, wiederum ein Wochenende, wurden daher umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen angeordnet und verlautbart. Unter Führung des Innenministeriums sollten Bahnpolizei, Polizei und Carabinieri zusammenarbeiten, was bürokratisch nicht immer sehr einfach war. Jedem Zug in der Region wurden Sicherheitskräfte beigestellt; sämtliche Bahnhöfe, Stationen und Haltestellen wurden rund um die Uhr überwacht. Die Bahnbediensteten hatten das Recht, Einzelreisende in Abteilen oder Waggons zu Gruppen zusammenzusetzen. Ganz allgemein wurde empfohlen, Reisen nicht allein, sondern - wenn möglich -immer in Gruppen zu unternehmen und besonders auf verdächtig wirkende, finster blickende, etwa vierzigjährige Männer mit dunkler Hautfarbe zu achten. Nach dem »Identikit« erstellte Steckbriefe wurden überall in der Region verteilt und angeschlagen.
Dass die allgemeine Aufregung die Arbeit der Task-Force und den Betrieb der Eisenbahn nicht einfacher machte, war klar. Tausenden Hinweisen aus der Bevölkerung musste nachgegangen werden; Zeuginnen meldeten sich, die früher schon in Zügen beim Betreten von Toiletten und Waschräumen von Unbekannten überfallen worden waren - möglicherweise hatte der Täter an ihnen seine Methode erprobt. Die Hinweise aber waren wenig zielführend, da die damaligen Vergehen nicht angezeigt worden waren und die nachträglichen Personenbeschreibungen durch die veröffentlichten Angaben beeinflusst sein konnten. Ein Intercity wurde in der Nähe von Genua auf offener Strecke angehalten und stundenlang von einem Großaufgebot von Bahnpolizei und Gendarmerie durchsucht, nur weil eine Waschraumtür geklemmt hatte.
Wahrscheinlich um den Täter noch mehr aus der Reserve zu locken, gab die Polizei der Presse bekannt, man habe neben der Leiche Elisabetta Zoppettis Körperflüssigkeit des Täters sicherstellen können - welcher Art diese Flüssigkeit war, wurde nicht angegeben -, und zwar in ausreichender Menge, um mit Hilfe der neuen kriminalistischen Wunderwaffe DNS-Analyse den Mörder sicher überführen zu können, selbst wenn alle anderen Beweise fehlen sollten.
Die so groß angelegten und angekündigten Sicherheitsmaßnahmen waren wirkungsvoll; zumindest in der Bahn verging das Wochenende um den 25. April ohne Mord. Die Einsatzgruppe hatte inzwischen fünf verschiedene Täterprofile ausgearbeitet und veröffentlicht; zusätzlich zum »Identikit« sollten sie die mögliche berufliche Stellung des Mörders eingrenzen.
Der Täter konnte demnach Nachtwächter in Genua sein, eine Stellung, die durchaus Bekanntschaft mit Prostituierten und Freizeit am Wochenende nahe legen und somit Opfer und Tatzeit erklären konnte. Vielleicht hatte er die zwei Nachtwächter, die dem Transsexuellen zu Hilfe gekommen waren, nur deshalb erschossen, weil sie ihn als Kollegen wieder erkannt hätten. Es war aber auch möglich, dass er Mitglied einer Wachgesellschaft oder einer offiziellen Ordnungstruppe war. Ein Zeuge hatte angegeben, im Intercity einen Verdächtigen in einer nicht näher spezifizierten Uniform gesehen zu haben. Zweifellos besaß der Mörder Kenntnisse über den Umgang mit Waffen; einem Laien wäre der eigentümliche Munitionstyp unbekannt und unzugänglich gewesen. Ebenso konnte er natürlich Eisenbahner sein, was nicht nur seine ausgezeichnete Fahrplan- und Streckenkenntnis, sondern auch seine Kaltblütigkeit und Sicherheit bei der Bewegung im Waggon erklären würde. Vielleicht handelte es sich auch um einen Pendler, der nur über die Wochenenden in Italien wohnte und in Frankreich, z. B. in der Gastronomie, arbeitete. Am wahrscheinlichsten aber schien der Beruf eines Handelsvertreters, zu dem die gute Ortskenntnis des Gebietes und der Zugverbindungen und der Besitz eines Autos (schwarzer Mercedes) ebenso passten wie die Bekanntschaft mit Damen der Straße oder die Freizeit am Wochenende.
Abgesehen von den Morden an den Prostituierten, die eindeutig einem Täter zugeordnet werden konnten, war die Umgebung Genuas seit Beginn des Jahres von einer erschreckenden, beispiellosen Mordepidemie heimgesucht worden. Alle Taten waren noch ungeklärt, auch die Motive nicht immer eruierbar. Am 16. Oktober 1997 war der polizeilich bekannte Spieler Centanaro Giorgio erwürgt in seiner Wohnung in Genua gefunden worden, getötet vermutlich wegen einer Wettschuld oder unterschlagener Gewinne aus illegalen Spielen. Am 24. Oktober 1997 waren der Videovertreter Maurizio Parenti und seine Frau Carla Scotto erschossen worden, ebenfalls in Genua. Auch sie hatten sich häufig in Kreisen illegalen Glücksspiels bewegt. Drei Tage später waren der Goldschmied Bruno Solari und seine Frau Maria Luigia Pitto in Albenga gestorben. Motiv: Raubmord. Am 13. November war der Geldwechsler und Spieler Luciano Marro in Ventimiglia ermordet worden, am 20. März sein Kollege Enzo Gorni. Dazwischen, am 25. Januar, war der Nachtwächter Giangiorgio Canu im Lift eines Genueser Palazzo erschossen aufgefunden worden.
Die Task-Force musste sich die Frage stellen, inwieweit nicht auch diese Morde, oder wenigstens einige davon, auf das Konto des Monsters von der Riviera gehen könnten. Bisher hatte man die Täter eher in Kreisen des organisierten Verbrechens, das die Glücksspiel- und Wettszene beherrschte, gesucht. Doch mit Ausnahme des ersten waren alle Opfer durch Schüsse aus einer großkalibrigen Pistole mit der selten verwendeten mantellosen Bleimunition getötet worden. Der Verdacht wurde akut, als am 21. April der Tankwart Giuseppe Mileto an seinem Arbeitsplatz in Arma di Taggia, an der Straße von Ventimiglia nach Pietra Ligure, erschossen wurde. Motiv: Raub. Die Tatwaffe: eine großkalibrige Pistole mit der mittlerweile bekannten Munition. Der Mord an Maria Angela Rubino im Zug nach Ventimiglia lag erst drei Tage zurück, und Ventimiglia war nur wenige Kilometer von Arma di Taggia entfernt.
Der Öffentlichkeit wurden diese möglichen Zusammenhänge nicht mitgeteilt. Der Corriere della Sera erstellte noch in seiner Ausgabe vom 26. April eine makabre Liste darüber, wie viele Morde die einzelnen Tageszeitungen dem noch unbekannten Mörder aufrechneten. La Stampa führte mit acht, vor dem Corriere selbst mit sechs, La Repubblica und La Nazione folgten mit fünf, wogegen Ii Giornale und // Secolo XIX demselben Täter »nur« vier Morde zuschrieben.
Zur Verhaftung des brutalen Mörders, dessen Geständnis die Annahmen der Zeitungen um ein Vielfaches übertreffen sollte, führte aber schließlich die aufwendige Schreibtischarbeit der Ermittler. Sie verglichen das nach den Zeugenangaben gezeichnete Phantombild mit den Porträtphotos aus der Kartei vorbestrafter Sexualverbrecher und legten dann diese Bilder dem einzigen überlebt habenden Tatzeugen, dem Transsexuellen Julio Castro, vor - mit Erfolg.


Das Phantombild Bilancias...und das Foto des Tatverdächtigten in den Polizeiakten
Am 28. April meldeten die Zeitungen, ein Verdächtiger sei mit achtzigprozentiger Sicherheit auch namentlich identifiziert. Am 7. Mai wurde, zur Erleichterung des ganzen Landes, die Verhaftung von »il serial killer« bekannt gegeben. Er hieß Donato Bilancia und war 47 Jahre alt, ein Kleinkrimineller, der behauptete, vom Glücksspiel zu leben. Geboren in Süditalien, in Potenza, war er schon als Kind mit seinen Eltern nach Ligurien gekommen, hatte Anpassungsschwierigkeiten und kam früh mit dem Gesetz in Konflikt. Er war mehrmals vorbestraft, wegen Eigentumsdelikten, zweier Raubüberfälle und immer wieder wegen betrügerischen Glückspiels. 1990 hatte er einer Prostituierten, die ihn wegen allzu sadistischer Sexualpraktiken der Polizei melden wollte, mit ihrer Ermordung gedroht, was ihn einschlägig polizeibekannt gemacht und in der Folge zu seiner Identifizierung geführt hatte. Detektive hatten ihn in einer Bar in der Nähe seiner Wohnung in der Via Mondato ohne Widerstand festgenommen. Seine Eltern lebten in Cogoleto, nur zweihundert Meter neben dem Fundort der Leiche der nigerianischen Prostituierten Evelyn Edsohe entfernt.
Erkennungsdienstliche Erfassung des Donato Bilancia und... gefasst: "...endlich".

Eine - allerdings tragische - Beziehung hatte seine Familie bereits zur Eisenbahn. 1987 hatte sich Donatos Bruder Michele
mit seinem kleinen Sohn im Arm vor einen Zug auf der Linie Genua-Ventimiglia gestürzt. Beide waren getötet worden. Donato soll zur Identifizierung der verstümmelten Leichen geholt worden sein.
Bilancia besaß einen nachtblauen Mercedes 190 mit dem Kennzeichen AE 106 AW, wie ihn der schwer verletzte Transsexuelle Julio Castro beschrieben hatte. Er hatte auch eine Pistole der Marke Smith & Wesson Special, Kaliber .38, und einige Pakete der Munition Marke »Wadecutter«. Die Kriminalbeamten konnten außerdem bei der Verhaftung in der Bar ein Glas sicherstellen, aus dem Bilancia getrunken hatte, um einen DNS-Vergleich mit den Tatortspuren zu ermöglichen.


Der beschlagnahmte Mercedes Bilancias. Ein Auszug aus einem Geständnis.
Angeklagt wurde Bilancia vorerst nur wegen der Morde an den vier Prostituierten, an den beiden Nachtwächtern und an den zwei Frauen in der Eisenbahn. Am 11. Mai wurden ihm die Morde an Zoppetti und Rubino nachgewiesen, am 12. Mai gestand er die Morde an vierzehn Personen. Am 14. Mai um 17 Uhr 45 legte der Serienmörder dann in der Carabinieri-Kaserne von Molassana vor dem stellvertretenden Staatsanwalt von Genua, Enrico Zucca, sein endgültiges Geständnis (über siebzehn Opfer) ab.
Er wolle in chronologischer Reihenfolge alle Verbrechen zugeben und würde auf sämtliche Fragen antworten, sagte Bilancia, aber nur jetzt. Einen kompetenten Psychologen oder Psychiater würde er bestenfalls für Fragen nach dem Motiv zulassen. Die ersten Morde, mit denen alles begonnen hätte, seien die an Centanaro Giorgio und dem Ehepaar Parenti gewesen. Der Tod der Frau tue ihm Leid, den beiden Männern wäre jedoch nur recht geschehen, sie hätten ihm Böses angetan, vor allem Parenti, der seine Freundschaft verraten hätte.
Als nächste Tat folgte der Raubmord an dem Juwelierehepaar Solari. Deren Adresse habe er von dem Mann erhalten, der ihm den Mercedes geliehen habe, als gute Gelegenheit für einen Diebstahl. Dann sei der Geldwechsler in Ventimiglia an der Reihe gewesen. Erst später habe er sich die Prostituierten vorgenommen. Neben den Morden an den vier Prostituierten und den beiden Frauen im Zug gestand Bilancia noch, die Nachtwächter Giangiorgio Canu, Candido Randö umd Massimo Gualillo und den Tankwart Giuseppe Mileto getötet zu haben. »Das sind alle, mehr habe ich nicht umgebracht«, stellte Bilancia nach dieser Bilanz des Grauens kategorisch fest. »Schon nach den ersten drei Morden hatte ich mir überlegt, mich selbst umzubringen, aber das hätte bedeutet, mir selber Schmerz zuzufügen; etwas, was ich nie konnte.«
Bilancia versuchte, sich auf eine Art »Ausnahmezustand« auszureden, in dem er sich bei den Morden befunden hätte. Im Kopf sei ihm jedesmal ganz kalt gewesen und irgendeine innere Stimme hätte ihn zu den Morden getrieben. Für die Psychiater waren Persönlichkeitsstruktur, Herkunft und Umfeld typisch für einen Serienmörder, auch im Vergleich mit den vom FBI erstellten Psychogrammen: ein grotesk übersteigertes Selbstbewusstsein, das Bilancia auf jede noch so kleine und unbedeutende Einschränkung mit unkontrollierbarer Aggression reagieren ließ. Seine Taten, so unterschiedlich sie auch sein mochten, waren einem zentralen Motiv zuzuordnen - der Rache für eine angeblich erlittene Kränkung. Rache an seinen Kumpanen, die ihn beim Glücksspiel übervorteilt hatten, Rache an dem Juwelierehepaar, das ihn nach seinem missglückten Einbruchsversuch der Polizei übergeben wollte, Rache an den Frauen, denen gegenüber er seine Männlichkeit nicht ausleben hatte können.
Natürlich musste auch seine Umgebung mit in Betracht gezogen werden, die süditalienische Herkunft mit ihren traditionellen Vorstellungen männlicher Identität, die mit den Gegebenheiten seiner neuen Heimat in Konflikt geraten mussten; die familiäre Situation, der autoritäre Vater, mit dem er ständig stritt, die nachgiebige Mutter; und auch das kriminelle Milieu, in das er schon in jungen Jahren geraten war und in dem Aggressionshandlungen als übliche Umgangsform galten. Das traumatische Erlebnis des Todes seines Bruders und Neffen könne - so die Experten höchstens als Auslöser, nicht aber als zentrales Motiv für die Morde gesehen werden. Bilancia sei jedenfalls nicht geisteskrank und für seine Taten voll verantwortlich.
Auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Mord an Elisabetta Zoppetti im Intercity La Spezia-Venedig wurde Bilancia vom Corte d'Assise in Genua, dem Schwurgericht, schuldig gesprochen. Nach nur fünfstündiger Beratung, eine knappe Viertelstunde für jede Tat, verneinten die Geschworenen einstimmig die Unzurechnungsfähigkeit wegen Geistesstörung und setzten die Höchststrafe fest: dreizehnmal lebenslänglich mit achtundzwanzig Jahren Isolationshaft unter erschwerten Bedingungen. Bilancia war bei der Urteilsverkündung nicht zugelassen, das Urteil wurde ihm ins Untersuchungsgefängnis in Chiavari übermittelt.
Quellen: Mord-Express (von Peter Hiess und Christian Lunzer) Ausgabe 2000 - S. 19 - ISBN 3-216-30550-3
4. Der Fall – Fast Eddie Leno

Den Drogendealern in und um Flint in Michigan stand im September 1990 ein großes gesellschaftliches Ereignis ins Haus: Fast Eddie Leno, ein vor kurzem in der Region aufgetauchter Drogenfürst, gab sich die Ehre, die „Kollegen" zur Hochzeit seiner Tochter Debbie mit einem seiner Günstlinge, Danny Brown, einzuladen. Die Drogendealer kannten diese Leute zwar kaum, doch da Leno und Brown zu wichtigen Kunden werden konnten, nahmen zwölf der Dealer die Einladung an.
Das Fest schien gut organisiert zu sein. Am Eingang des gemieteten Saals wurden die Gäste gebeten, ihre Waffen an der Garderobe abzugeben, und sie durften erst nach einer Überprüfung mit einem Metalldetektor in die Halle hineingehen. Nach der Zeremonie wurden Toasts ausgebracht, Musik erklang, und man tanzte etwa eine Stunde lang.
Fast Eddie war zweifellos ein Mann von Format: Auf jedem Tisch lagen Streichholzbriefchen, bedruckt mit den Namen der Brautleute und der Aufschrift: „Vielen Dank, daß Sie unsere Freude teilen.“
Die Band spielte nun „I Fought the Law (And the Law Won)"- Ich kämpfte gegen das Gesetz (und das Gesetz siegte).
Eine Stimme forderte alle anwesenden Polizisten auf, sich zu erheben. Über die Hälfte der Gäste stand auf. Die Braut zog unter ihrem Kleid einen Revolver hervor; Fast Eddie (in Wahrheit ein Chef der Ortspolizei) holte aus seinem Kummerbund eine Walther-Pistole; der Pfarrer zauberte aus den Falten seines Talars eine 9-mm-Halbautomatik, und auch Mitglieder der Band (die sich SPOC nannte, die Umkehrung von COPS) zückten Feuerwaffen, so daß jeder Widerstand sinnlos schien. Der angebliche Danny Brown zeigte den Gästen eine Reihe Haftbefehle.
Die „Hochzeit" ersparte der Polizei die Mühen und Risiken, die Dealer einzeln zur Strecke zu bringen. Die Drogenhändler waren verständlicherweise wütend. Als sich die gutgelaunten Polizisten mit ihren Gefangenen den Pressephotographen stellten, bemerkte einer der Dealer - eigentlich unnötigerweise-, er wäre nicht gekommen, hätte er gewusst, daß man ihn verhaften werde.
Quellen: Die Welt de Verbrechens (von Naumann & Göbel) Ausgabe – S. 32 – ISBN 3-625-10644-2
5. Der Fall - Sadamichi Hirasawa
Die Angestellten einer Zweigniederlassung der Teikoku-Bank in Shiinamachi, Japan, schöpften keinen Verdacht, als am 26. Januar 1948 ein Mann die Bank betrat und sie bat, eine unangenehm schmeckende Mixtur zu trinken. Der Besucher gab sich als Arzt der Tokioter Gesundheitsbehörde aus und erklärte, das Mittel würde die Angestellten vor einer grassierenden Ruhrepidemie schützen. Minuten nach Einnahme der Tropfen waren zehn Angestellte tot und vier andere gelähmt, nur einer konnte später der Polizei den Besucher beschreiben. Die angebliche Medizin entpuppte sich als Zyankali, der „Arzt" als ein Bankräuber, der sich diesen grausamen Plan ausgedacht hatte. Der Verbrecher kassierte 500 Dollar in bar, eine beträchtliche Summe im Nachkriegsjapan, übersah aber einen offen stehenden Safe, in dem noch ein wesentlich größerer Betrag aufbewahrt war.
Im Laufe der Ermittlungen stellte die Polizei fest, daß der Überfall auf die Teikoku-Bank bereits der dritte - aber einzige erfolgreiche - Versuch des Giftmörders gewesen war, ein Geldinstitut auszurauben.

Einige Monate zuvor hatte sich in einer Bank in Tokio schon einmal ein Mann als Beamter vom Gesundheitsamt vorgestellt und ein angebliches Mittel gegen eine Epidemie verteilt. Das Gift hatte aber nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, so daß der potentielle Raubmörder unverrichteter Dinge abziehen mußte. Eine Woche vor dem Überfall auf die Teikoku-Bank war der Mann in einem Geldinstitut erschienen, um angeblich im Auftrag der Gesundheitsbehörde verseuchtes Geld zu desinfizieren. Der Filialleiter hatte den „Beamten vom Gesundheitsamt" barsch abgewiesen, woraufhin der Mann die Bank verließ.
Von dem Verbrecher fehlte jede Spur. Die Polizei befragte über 5000 Personen und bat einige Kriminalschriftsteller, mögliche Szenarien zu ersinnen, um so vielleicht des Bankräubers habhaft zu werden. Doch alle Bemühungen waren umsonst.
Sieben Monate später, am 21. August, verhaftete die Polizei den Künstler Sadamichi Hirasawa, der in der Mähe der Bank gewohnt hatte. Auf ihn traf die Beschreibung zu, die einige der Überlebenden von dem Mörder abgegeben hatten. Hirasawa war in jüngster Zeit zu viel Geld gekommen und kurz nach dem Verbrechen aus der Wohnung ausgezogen. Er benutzte zudem Blausäure bei seiner Malerei. Obwohl es keine überzeugenden Beweise gab, verurteilte man den Künstler zum Tode.
Hirasawa ging mehrmals in Berufung. Die Strafe wurde nicht vollstreckt, aber Hirasawa kam nicht frei. Er sollte zu jenen Häftlingen gehören, die am längsten in einer Todeszelle verwahrt wurden. Von Juli 1950 bis Mai 1987 saß er im Miyagi-Gefängnis ein, wo er im Alter von 95 Jahren starb.
Quellen: Die Welt de Verbrechens (Naumann & Göbel) Ausgabe – S. 77 – ISBN 3-625-10644-2
6. Der Fall - Beverly Allitt
Beverly Allitt, geboren am 4. Oktober 1968 in Nottingham, ist eine englische Serienmörderin.


Beverly Allitt fiel bereits in früher Jugend durch Grausamkeiten an Kindern auf. Diese Verhaltensstörung sollte später bis zum Mord führen. Im Jahr 1991 nahm Beverly Allitt eine Stelle in einem Hospital in Grantham an.
 Kurz nach ihrer Einstellung stieg die Sterberate unter den dort behandelten Kindern drastisch an. Im Februar und März 1991 kam es zu unerklärlichen Todesfällen an einem sieben Wochen alten Baby und einem elfjährigen Jungen. Beide starben an einem Herzinfarkt. Die Tatsache, dass das Herz des Babys Verschleißerscheinungen trug, wie sie sonst nur bei Erwachsenen zu finden sind, stellte die Ärzte zwar vor ein Rätsel, aber niemand schöpfte Verdacht. So konnte Allitt weitere Kinder töten.
Kurz nach ihrer Einstellung stieg die Sterberate unter den dort behandelten Kindern drastisch an. Im Februar und März 1991 kam es zu unerklärlichen Todesfällen an einem sieben Wochen alten Baby und einem elfjährigen Jungen. Beide starben an einem Herzinfarkt. Die Tatsache, dass das Herz des Babys Verschleißerscheinungen trug, wie sie sonst nur bei Erwachsenen zu finden sind, stellte die Ärzte zwar vor ein Rätsel, aber niemand schöpfte Verdacht. So konnte Allitt weitere Kinder töten.
Rampton Maximum Security Hospital
Als schließlich Ende März ein fünf Monate altes Kind immer wieder das Bewusstsein verlor, wurde man misstrauisch. Das Blut des Kindes wurde analysiert und man stellte eine Überdosis Insulin fest. Die alarmierte Polizei fand heraus, dass in der Krankenakte des Kindes Seiten fehlten. Diese fand man im Zimmer von Beverly Allitt. Außerdem wurde festgestellt, dass sich die Vorfälle immer dann ereigneten, wenn Schwester Beverly Dienst hatte.
Beverly Allitt wurde 1993 u. a. wegen vierfachen Mordes zu dreizehnmal lebenslänglicher Haft verurteilt. Sie sitzt ihre Strafe gegenwärtig im Rampton Maximum Security Hospital für psychisch erkrankte Straftäter ab.
Quellen: - wikipedia, Fotoergänzungen
7. Der Fall – Hans M. (Name verändert)
Wie in jedem Jahr, so war auch in diesem Februar des Jahres 1984 Faschingszeit. So auch in Weimar. Zu dieser Zeit gab es in der DDR nur einige Hochburgen des Karnevals, wie z. B. in Wasungen. Ansonsten blieben die ausgelassenen Feiern lokal beschränkt in bestimmten Einrichtungen.
In Weimar waren es in erster Linie die Studenten der Hochschule für Architektur und Bauwesen, die im „Kasseturm“ und in der „Schütze“ (Internat in der Schützengasse) ein fröhliches Treiben führten. Aber auch im „Volkshaus“, im damaligen FDGB-Haus in der Wilhelm-Pieck-Straße wurden durch Studenten, Sportler und Bürger der Stadt Traditionen des Faschings gepflegt. Auch die Handwerker veranstalteten, ihrer Tradition folgend, ausgezeichnete „Sitzungen“. Ein Malermeister, Leo der Beleibte genannt, war dabei federführend. Zeitzeugen erinnern sich gerne an diese Faschingstage, da Humor und Komik das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen förderten.
Doch nicht für alle Menschen, sollte der Fasching Lustiges oder gar Komisches bringen. In den Nachmittagsstunden eines Tages im Februar begab sich Annemarie Krause von Zu Hause aus auf den Weg zum Kirschberg, wo ihr Mann arbeitete. Dabei passierte sie den Steg an der Ilm an der sogenannten „Hundewiese“. Den Namen führte dieser Platz, weil dort die Hundebesitzer die Möglichkeiten zur Abrichtung und Dressur ihrer Tiere erhielten.
Als Frau K. über den Ilmsteg ging, schaute sie unvermittelt in das eiskalte strömende Gewässer und erschrak aufs heftigste. Unmittelbar neben dem Steg, befand sich ein im Wasser liegender menschlicher Kopf. Er hatte sich im Strauchwerk, das bis in die Ilm ragte, verhakt. Ihrer Meinung nach war es der Kopf einer Frau. Aber war es wirklich der Kopf einer Frau oder wegen der
Faschingszeit ein Gebilde aus Pappe mit Knete und Leim?
Annemarie K. holte ihren Mann von der Arbeit ab und erzählte ihm von ihrer Entdeckung. Auch der Ehemann Kurt K. konnte nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es sich um einen menschlichen Kopf oder ein karnevalistisches Kuriosum handelte. Die Eheleute entschlossen sich trotzdem die Entdeckung der Polizei zu melden; glücklicherweise, denn so konnte eines der scheußlichsten Verbrechen der thüringischen Kriminalgeschichte aufgedeckt werden.
Die eingesetzten Polizisten äußerten anfänglich ebenfalls Zweifel, aber bei der Bergung wurde es zur Gewißheit, daß es sich um einen menschlichen, weiblichen Kopf handelte.
Nachdem ich als Leiter der Untersuchung verständigt wurde, schickte ich eine komplette Mordkommission unter Leitung von Peter Sch. nach Weimar. Ich selbst hatte den kürzesten Anmarschweg, da ich in Weimar wohnte. Die Gerichtsmedizin Jena wurde verständigt und traf nach 90 Minuten ein. Was war festzustellen?
Das Gesicht der Toten war relativ gut erhalten, was zweifellos am kalten Wasser der Ilm lag. Außerdem gab es kaum sogenannte „Treibverletzungen“, die durch das Treiben im Wasser durch Strauchwerk, Holzbretter oder Sonstigem verursacht werden. Somit konnte festgestellt werden, daß der Kopf nicht sehr weit entfernt vom Fundort in das Wasser gelangt war.
Der Frauenkopf hatte schwarze, mittellange Haare. Ein wichtiges Merkmal bei der Identifizierung unbekannter Toter ist der Zahnstatus. Bei der unbekannten Toten wurde festgestellt, daß sie ca. 30-35 Jahre alt sein konnte. Ihr Gebiß wies verfaulte Zahnstümpfe auf, die Hinweise auf Ungepflegtheit und Asozialität gaben. Am Hals war festzustellen, daß der Kopf traumatisch vom Körper getrennt wurde. Ein sehr scharfes Tatwerkzeug war dafür ursächlich. Zum Vorliegen eines Tötungsverbrechens gab es überhaupt keine Zweifel.
Da das Gesicht der Getöteten relativ gut erhalten war, wurde ein Halstuch zur Abdeckung der Schnittstellen genommen und ein Kopfporträt angefertigt. Niemand konnte am Foto erkennen, daß es sich nur um einen Kopf handelte. Das Bild erschien in den lokalen Zeitungen, mit der Bitte um Hinweise zur Identität der abgebildeten Person. Zudem wurden alle im Kriminalregister erfaßten Vermißten überprüft – ohne Erfolg.
Aufgrund des katastrophalen Zahnstatus` richtete sich die Ermittlung auf den – wie es damals hieß – „asozialen Bereich“ Weimars aus. Erst wenn die Identität der Toten feststand, ließen sich weitere Ermittlungen ableiten!
Eine weitere, entscheidende Frage war, wo die anderen Körperteile der geschädigten verblieben waren. Der Kopf lag in der Ilm, warum nicht die restlichen Teile?
Tagelang waren Feuerwehrleute mit Spezialisten im Einsatz. Sie suchten die Ilm über eine Länge von zwei Kilometern ab, leider erfolglos. Nichts wurde von der Unbekannten gefunden. Die Wehre wurden ständig überprüft, ebenfalls ohne Erfolg. Da es zu dieser Zeit enorm viele Wasserratten gab, fragten wir uns, ob diese in der Lage gewesen wären einen ganzen Menschen zu fressen, inklusive Knochen?
Nach einer Woche erhielten wir plötzlich Unterstützung von „Kommissar Zufall“. Beim Kreisstaatsanwalt von Weimar, Dieter R., meldete sich ein mehrfach vorbestrafter Mann aus der Haft zurück und fragte, ob seine „Verlobte“ Marion Kramer in der Zeit seines Haftaufenthaltes inhaftiert worden sei, da er sie nicht mehr angetroffen habe. Nachdem ihm das Fahndungsbild vorgelegt wurde, brach er schmerzlich berührt zusammen.
Er erkannte Marion K. ohne Zweifel auf dem Foto. Damit begannen die Ermittlungen in einer neuen Qualität. Konkret konnte jetzt das Umfeld des Opfers aufgeklärt werden. Hier sei noch angemerkt, daß ihr Vater sie auf dem Foto nicht erkannt hatte! Zu seiner Entschuldigung sei gesagt, daß er sich kaum um die Belange seiner Tochter gekümmert hatte und schon gar nicht die letzten Zwei Jahre vor dem verbrechen, wo Marion allein in einer Wohnung „hauste“. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich die Erkenntnis von ihrer asozialen Lebensweise. Sie ging weder einer geregelten Arbeit nach, noch kümmerte sie sich um lebenswichtige Belange. Stattdessen machte sie häufig „Männerbekanntschaften“ und ließ sich von ihnen aushalten.
Marion K. war einmal ein gut aussehendes Mädchen mit – wie sagt man so schön – rassigen Zügen. Leider rutschte sie im Laufe ihres Lebens immer tiefer in die Asozialität. Durch den ständigen Alkoholgenuß und die damit einhergehende Abhängigkeit vernachlässigte sie ihr Äußeres. Fehlende hygienische Pflege taten ein Übriges, um aus der ehemals schönen Frau eine heruntergekommene, ausgemergelte Alkoholikerin zu machen. Das erklärt auch den katastrophalen Zustand ihrer Zähne.
Es war zu untersuchen und aufzuklären, mit wem die 28jährige Frau in letzter Zeit verkehrte und wer sie noch gesehen hatte. Alle einschlägig bekannten Sexualstraftäter bildeten eine Gruppe potenzieller Täter. Ein weiterer Ansatzpunkt der Ermittlungen war die Annahme, daß der oder die Täter mit dem Kopf und eventuell mit den anderen Körperteilen keinen weiten Weg bis zur Fundstelle an der Ilm gegangen waren. Aber wer wohnte von den einschlägig vorbestraften Personen im Umkreis von einem Kilometer?
Das Ergebnis war viel versprechend. Ganz in der Nähe hatte der mehrfach vorbestrafte Hans M. vor einem Jahr eine Parterrewohnung bezogen. Ich erinnere mich noch, daß er bereits als Jugendlicher im Goethepark unterhalb der Sternbrücke hinter dem Schloß Frauen anfiel und versuchte, sie bestialisch sexuell zu nötigen. Im Mauerwerk der Brücke war in einem Pfeilersegment ein ca. 2 Meter offenes Rondell vorhanden. Hier zerrte er seine Opfer hin. Heute befindet sich dort ein Treppenaufgang. Einer der Geschädigten stach er mehrfach mit einem Stock in die Scheide und verletzte sie. Noch während des Krankenhausaufenthaltes versuchte das Opfer sich zu erinnern, wie sie den Täter beschreiben könnte.
Zur gleichen Zeit setzten wir jeden Abend bis in die Nachtstunden Polizistinnen als sogenannte „Lockvögel“ ein. Kriminalisten, ich selbst war mehrfach mit eingesetzt, observierten unsere Kolleginnen, um bei einem eventuellen Überfall des Täters sofort eingreifen zu können. In erster Linie mußten wir den Schutz der Lockvögel garantieren, gleichzeitig wollten wir aber auch den Täter stellen. Es waren abenteuerliche Einsätze – leider ohne Erfolg!
Nach mehreren Tagen kam die Nachricht aus dem Krankenhaus, daß die Geschädigte, Frau H., den mutmaßlichen Täter wiedererkennen würde. Ja, sie war fast überzeugt, ihn in Weimar schon öfters gesehen zu haben! Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus willigte sie ein, täglich in Begleitung eines Kriminalisten zu unterschiedlichen Zeiten durch die Stadt „spazieren“ zu gehen. Ihr Betrieb stellte sie für diese Aktion frei. Doch nach fast drei Wochen „Spazierengehens“ gab es noch immer keine Hinweise.
Die Observationsmaßnahmen im Goethepark wurden noch verstärkt – und auch das Nationaltheater „spielte“ mit! Täglich gegen 18 Uhr betrat ein gut aussehender Kollege das Theater, um es 20 Minuten später als recht attraktive weibliche Person zu verlassen. Mit aufreizendem Gang bewegte sich dieser umfunktionierte Mann im Park. Zum Glück für ihn dauerten die Einsätze nicht ewig. An einem Dienstag, gegen 15.30 Uhr, bewegte sich unser Pärchen, bestehend aus der Geschädigten und einem Kriminalisten, von der Schillerstraße in Richtung Markt. Plötzlich machte Frau H. ihren Begleiter auf einen jungen, ca. 17jährigen Mann aufmerksam, der ihrer Meinung nach der Täter war.
Unser Kriminalist sprach ihn unter der „Legende“ nach dem Weg zum Bahnhof an. Aber noch ehe der Mann begriff wie ihm geschah, hatte unser Kollege ihn in enen der nächsten Hausflure gezogen und ihm die Handfessel angelegt. Er sprach ihm die vorläufige Festnahme aus und nahm ihn mit in das Rathaus. Von dort wurde ein Funkwagen angefordert, der den nunmehr namentlich bekannten Hans M. zur Dienststelle brachte.
Die Alibiüberprüfung und das Wiedererkennen durch Frau H. sowie die Vergleiche mit den am Tatort gefundenen Schuheindrucksspuren mit seinem Schuhwerk (er verfügte lediglich über ein Paar Turnschuhe und einem Paar Halbschuhe) führten dazu, daß er ein umfassendes Geständnis ablegte.
Er wurde nach dem Jugendstrafrecht verurteilt und demzufolge bereits nach 1,5 Jahren wieder auf freiem Fuß.
Hans M. besuchte die Sonderschule in Weimar auf Grund festgestellter Debilität. Nach dem Schulabschluß kam er in die Berufsschule der Sonderschule, die den Namen Herders noch heute trägt. Die Zeit der Inhaftierung verzögerte seinen Abschluß. Er erhielt eine Teilausbildung als „Fluchtenmaurer“, das heißt, er wurde beim Mauern nur in der Mitte der hoch zu mauernden Wand eingesetzt. Simse, Ecken und Kanten sowie das Anfertigen von Türstürzen blieben den mit vollem Berufsabschluß tätigen Maurern überlassen. Seine Lernbrigade war längere Zeit auch auf dem Gelände des Schlachthofes eingesetzt. Zeugen konnten sich erinnern, daß Hans M. mit fanatischer Begeisterung beim Ausnehmen von Tieren, insbesondere von Schweinen, zugesehen hat. Er stahl während dieser Zeit mehrere Schlachtemesser.
Doch kommen wir zu den Ermittlungen in unserem mutmaßlichen Tötungsverbrechen zurück. Hans M. bewohnte, wie bereits erwähnt, eine im Erdgeschoß befindliche kleine Wohnung. Betrat man das Haus befand sich links die Korridortür, rechts eine durchgehende Wand zum Nebenhaus und geradeaus ging es zum Hof.
In der ersten Etage wohnte eine stadtbekannte Frau, die ständig wechselnde Männerbekanntschaften hatte. Diese Frauen wurden in den polizeilichen Berichten und unterlagen als HWG-Personen bezeichnet. HWG stand für „häufig wechselnder Geschlechtsverkehr“.
Elli G., so hieß die Frau, wollte eines Tages aus dem Fenster guckend gesehen haben, wie Hans M. mit einem zusammengerollten Teppich aus dem Haus ging. Da es bereits dunkel war, hatte sie nicht sehen können, ob etwas eingerollt war. Als Hans M. bemerkte, daß man ihn beobachtete, ging er ins Haus zurück.
An einem recht kalten Tag Ende Februar wurde Hans M. zur Kripo Weimar geholt, wo sich die Mordkommission mit ihm befaßte. Auf die Frage, ob er die Marion K. kennen würde, antwortete er mit „Ja“. Er hätte sie allerdings kurz nach Sylvester das letzte Mal in der Mitropa-Gaststätte am Bahnhof gesehen. Als ihm das Fahndungsbild gezeigt wurde, bemächtigte sich eine deutliche Blässe seines Gesichts und er fragte die Vernehmer, ob mit ihr etwas passiert sei.
Was Hans M. zu dieser Zeit nicht wußte, war der Umstand, daß zu dieser Zeit bereits eine Einsatzgruppe, bestehend aus Ermittlern und Kriminaltechnikern in seiner Wohnung die Spurensuche und –sicherung durchführten. Ich selbst begab mich ebenfalls in die Wohnung des M., da zuvor zwei sachverständige Gutachter sich nur relativ kurzzeitig in der Wohnung aufhielten und um Unterstützung baten. Warum sie Unterstützung anforderten, wurde nur allzu schnell klar.
Im sogennanten kombinierten Wohn- und Schlafraum herrschte ein unglaublich starker widerlicher Geruch nach Urin, erbrochenem, Kot, Schimmel und anderem festzustellen. Auf dem Fußboden lagen zwei Matratzen, die ebenfalls mit Urin, Kot, vermutlich Spermien und Menstruationsblut beschmiert waren. Zwischen beiden Matratzen konnte ein Slip, wenn man das Stück Stoff noch als solchen bezeichnen konnte, gefunden werden. Der sich im Raum befindliche Nachtschrank wurde wie alle anderen Behältnisse und Schränke durchsucht.
Auffallend war, daß sich auf der hölzernen, inneren Bodenplatte des Nachtschrankes Abtropfungen von Blut fanden. Es sah aus, als hätte dort längere Zeit ein stück Fleisch gelegen. Die Kriminaltechniker fanden im Ofen (es handelte sich um einen Kanonenofen) Reste von einem Beutel aus Jeansstoff mit Blutanhaftungen und geringen Fleischpartikeln. Am oberen inneren Türrahmen waren rechts und links zwei Metallhaken in das Holz eingeschlagen. An einem Haken hing noch das Stück eines Hanfseiles.
In der sogenannten Küche und in der Toilette herrschten katastrophale Zustände. Verdrecktes Geschirr, schmierige Gläser und Flaschen jeglichster Art mischten sich mit verkommenen Kleidungsstücken und Unrat.
Desweiteren wurde in der Toilette eine Zinkbadewanne vorgefunden, an deren Innenbodenritzen Blutreste sichtbar waren, obwohl sie offensichtlich mit Wasser ausgespült worden war. Unter der Wanne lag ein Schlachtemesser mit Blutresten, die natürlich vertrocknet waren. Das erklärte insgesamt das zögernde Verhalten der Gutachter.
Es war eindeutig, daß wir uns am Tatort des Verbrechens an Marion K. befanden. Das Ergebnis der ausgewerteten Spuren erbrachte folgendes: Der Slip gehörte nachweislich dem Opfer. Die Blutgruppenbestimmung ergab, daß es sich um das Blut der Geschädigten handelte. Die bereits früher von Marion K. genommenen Fingerabdrücke, die daktyloskopischen Spuren, waren teilweise identisch mit denen auf Gläsern, Flaschen und Geschirr. Wenn es damals schon DNA-Untersuchungen gegeben hätte, wäre die Beweisführung und somit die Aufklärung wesentlich erleichtert worden.
Als wir Hans M. mit den gesamten Umständen sowie dem Beweismaterial konfrontierten und sich daraus der Vorhalt ergab, daß nur er für den Tod von Marion K. verantwortlich sein konnte, legte er nach kurzem Leugnen ein Geständnis ab. Was nun folgte, ähnelt in seiner ganzen Grausamkeit den blutigen Darstellungen in einem modernen Horrorfilm.
Hans M. kannte die Marion K. schon längere Zeit. Ihm war auch bekannt, daß ihr „aktueller“ Freund eine Freiheitsstrafe zu verbüßen hatte. Zufällig traf er das Opfer Mitte Januar in einer Kneipe in Weimar. Beide tranken erhebliche mengen Alkohol. Im weiteren Verlauf des „Besäufnisses“ machte Hans M. der Marion den unzweideutigen Vorschlag, zu sich nach Hause zu gehen. Marion K. war sofort einverstanden, zumal Hans erklärte, noch über Bier und Schnaps zu verfügen.
In der asozialen „Bude“ angekommen tranken beide noch einige Schnäpse, legten sich auf die Matratzen und machten das Radio an. Als Hans M. anfing, Marion zu küssen und zwischen die Beine zu greifen, zog sich die Frau willig aus. Auch Hans M. entkleidete sich. Danach schliefen beide ein. So blieb Marion K. mehrere Tage in der Wohnung des Täters. Dieser verließ nur das Haus, um etwas zu essen und natürlich alkoholische Getränke zu „besorgen“, sprich zu stehlen. Das asoziale Liebespaar war täglich betrunken und widmete sich gelegentlich dem Geschlechtsverkehr.
Es kam der fünfte Tag ihres Beisammenseins, als Marion K. den Geschlechtsverkehr ablehnte und sich verweigerte. Wahrscheinlich war ihr Hans M. zu brutal. Darüber geriet der angetrunkene Hans M. in Wut und drohte ihr, sie umzubringen, wolle sie ihm nicht zu Willen sein. Doch Marion K. unterschätzte die bedrohliche Situation und reagierte überhaupt nicht auf die Äußerungen des Mannes. Man muß davon ausgehen, daß Marion K. ebenfalls stark alkoholisiert war. Hans M. verlor die Gewalt über sich. Er legte beide Hände um seine „Geschlechtspartnerin“ und drückte zu. Seiner Meinung nach war sie bereits nach ca. 30 Sekunden tot. Angesichts der toten Frau war ihm klar, daß die Leiche aus dem Haus geschafft werden mußte. Er zog einen unter den beiden Matratzen liegenden, völlig verfilzten und verdreckten Teppich vor und wickelte die Leiche darin ein. Sein Plan bestand darin, die Leiche im waldähnlichen Gebiet „Webicht“, welches an die Ilm angrenzte, verschwinden zu lassen. Als es dunkel wurde, verließ er das Haus. Auf der Schulter trug er die in den Teppich eingewickelte Leiche.
Doch er wurde, wie bereits gesagt, beobachtet. „Was trägst Du denn da weg?“ krächzte Elli G. aus dem Fenster ihrer Wohnung gelehnt zu ihm herunter. Hans M. erschrak. Schnell lief er mit seinem furchtbaren Gepäck in die Wohnung zurück. Irgendwie muß ich die Leiche verschwinden lassen, dachte er. Und wie er noch darüber nachsann, schossen ihm seine Erinnerungen aus dem Schlachthof ins Gehirn. Wie hatten die Fleischer dort die Schweine zerlegt und auseinander genommen?
Hans M. ging mit irrem Blick durch seine Wohnung. Seine Augen suchten das größte, einst von ihm gestohlene Schlachtemesser. Er fand es unter einem Berg von dreckigem Geschirr. Die rostfreie, ca. 8 cm breite und stolze 65 cm lange Klinge glänzte. Mit dem Daumen fuhr er vorsichtig über die Schneide. Sie war scharf wie eine Rasierklinge. Ja, das würde gehen, dachte er. Dann suchte er seine aus Hanf gedrehte Wäscheleine. Von ihr schnitt er zwei ca. 60 cm lange Teile ab. Mit einem Hammer schlug er nun die zwei Stahlhaken über der Tür in den oberen Türrahmen rechts und links ein. Nachdem das geschehen war, trug er seine Zinkbadewanne, die er zum Abwaschen, der Körperreinigung und teilweise auch zur Verrichtung der Notdurft gebraucht hatte, direkt unter den Türrahmen.
Jetzt rollte er die Leiche von Marion K. wieder aus dem Teppich heraus. Mit einiger Mühe ergriff er je ein Bein der Leiche und umwickelte es mit einem Stück Wäscheleine. Doch trotz seiner körperlichen Kräfte kostete es ihn einige Mühen, die Beine der Leiche an die jeweils dafür vorgesehenen Haken mit den Stücken Wäscheleine festzubinden. Als das geschehen war, hing die Leiche mit gespreizten Beinen wie ein geschlachtetes Tier vor ihm im Türrahmen. Der Kopf lag auf dem Boden der Zinkwanne.
Als der Täter sein zum „Ausnehmen“ vorbereitetes „Schlachtvieh“ vor sich sah, entschloß er sich, zuerst den Kopf abzutrennen. Das gewaltige Schlachtemesser leistete ihm dazu hervorragende Dienste. Nachdem der Kopf abgetrennt war, packte er ihn an den Haaren und stellte ihn mit der blutigen Halsseite nach unten auf die Bodeninnenplatte des Nachtschrankes ab.
Dann arbeitete er als Fleischer weiter. Wie er es im Schlachthof gesehen hatte, öffnete er mit dem scharfen Schlachtemesser die weiche Bauchdecke der Leiche über der Scham beginnend bis unterhalb des Brustkorbes. Mit zitternden Händen weidete er sein Opfer aus. Er entnahm alle Innereien, dabei auch den Brustbereich aufbrechend. Dann verstaute er sie in einem Plastebeutel, den er dann in den Jeansstoffbeutel steckte. Mit diesem Inhalt begab er sich zur Ilm, die nur etwa 200 Schritte von seinem Haus entfernt vorbei floß. Dort schüttete er, von keinem Menschen beobachtet, die Innereien des Opfers ins Wasser und ging wieder nach Hause. Hier angekommen, begann er in seinem grausamen Werk fortzufahren. Er trennte nun die Beine ab, worauf der Torso in die Zinkwanne rutschte. Mit kräftigen Schnitten zerstückelte er auch diese und trug sie im genannten Beutel zur Ilm. Wieder sah kein Mensch das furchtbare Tun des Hans M., der sich mehrfach davon überzeugte, daß auch wirklich alle Leichenteile von der Strömung fortgerissen wurden.
Als er wieder zu Hause angekommen war, machte er erst einmal eine Pause. Die Gefühlskälte und Stupidität des Verbrechers, die einem Jack the Ripper alle Ehre gemacht hätte, ließen es zu, daß er sich eine Flasche Schnaps griff und betrank. Völlig „zu“ legte er sich auf eine seiner Matratzen und schlief ein.
Am nächsten Tag beendete der Mörder sein „Schlachtefest“. Er schnitt die Arme vom Rumpf und knickte sie in der Beuge zusammen. Um sie besser transportieren zu können, band er sie mit einem kurzen Strick. Dann begann er den mittlerweile ausgebluteten Torso zu zerstückeln.
Als es dunkel war, begab er sich noch viermal zur Ilm. Notdürftig säuberte er die Zinkwanne und den Fußboden von Blutspuren, Hautfetzen und Fleischresten. Diesen kläglichen Rest menschlichen Überbleibsels stopfte er in den Jeansbeutel. Dann schob er ihn in den Ofen. Danach verließ er das Haus, um sich neuen Alkohol zu besorgen. Zwischenzeitlich ging jedoch das Feuer aus, so daß für die Spurensucher wenige menschliche Überreste im Jeansbeutel haften blieben. Da Hans M. über kein Heizmaterial mehr verfügte, hielt er sich kaum noch in der Wohnung auf.
Der Mörder glaubte das perfekte Verbrechen begangen zu haben, denn niemand vermißte Marion K. Doch den Täter treibt es immer wieder an den Tatort zurück, sagt man, und so war es auch bei Hans M. Mehrfach führten seine Wege zu der Stelle, wo er sich der Leichenteile entledigt hatte. Der Mörder vergewisserte sich, daß kein Körperteil mehr sichtbar war oder zum Vorschein kommen konnte. Nun versuchte er „Abstand von der Sache“ zu bekommen.
Zwei Tage später suchte er nach Zigaretten und öffnete unvermittelt die Tür des Nachtschrankes. Doch wie groß war sein Entsetzen, als er darin den Kopf der Ermordeten sah. Besonders erschreckte ihn, so sagte er es in der Vernehmung, daß ihn die toten Augen Marions „angesehen“ hätten!
Hans M. verlor die Nerven, packte den blutleeren Kopf, wickelte ihn in Papier ein und lief zur Ilm. Da er sich so schnell wie möglich der greulichen Last entledigen wollte, ging er nicht zu seiner speziellen Stelle, sondern warf den Kopf vom oberen Uferrand aus über das Gestrüpp ins Wasser. Dann rannte er davon. Ein folgenschwerer Fehler, wie wir bereits gesehen haben.
Zu Hause angekommen grauste es ihm vor seinem Nachtschrank, in den er nie wieder hineinsah. Er glaubte, daß der Kopf immer wieder vor seinen Augen erscheinen würde. Aus diesem Grund trockneten die Blutabtropfungen fest und dienten der Beweisführung.
Der Kopf trieb indessen nicht im Wasser ab, sondern verhakte sich nach wenigen Metern an der späteren Fundstelle. Daher konnte er so schnell entdeckt und sichergestellt werden. Wir Kriminalisten haben in unserem Dienst gar manche Tragik, Dramatik und Brutalität erleben müssen, aber solch eine Verbringungsart des Opfers war extrem und auch für uns unfaßbar.
Hans M. mußte psychologisch und psychiatrisch begutachtet werden. Auf Grund seiner Debilität und seiner Alkoholabhängigkeit ging man von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Auch die Frage, ob er das Opfer tatsächlich töten oder nur gefügig machen wollte, konnte nicht beantwortet werden. Es wurde vom Gericht eine hohe Gefängnisstrafe ausgesprochen. Ob Hans M. jemals freigekommen ist, entzieht sich meiner Kenntnis
Quellen: Der Kopf in der Ilm - Ein Thüringer Kriminalist erzählt (Klaus Dalski) Verlag Kirchschlager
8. Der Fall – Dr. med. John Bodkin Adams
Dr. med. John Bodkin Adams, geb. 21. Januar 1899 in Randalstown; gest. 4. Juli 1983 in Eastbourne, war ein britischer Mediziner und Betrüger, der auch als Serienmörder angeklagt, aber freigesprochen wurde.
Zwischen 1946 und 1956 starben mehr als 160 seiner Patienten unter mysteriösen Umständen. 132 dieser Patienten hinterließen ihm in ihren Testamenten Geld oder Gegenstände. Am 19. Dezember 1956 wurde der Arzt von der Polizei unter Mordverdacht festgenommen.
Er stand im Jahre 1957 im Mittelpunkt eines Sensationsprozesses, der die ganze Welt erregte. Man hatte Dr. Adams angeklagt, Edith Morell - einer reichen alten Witwe – im Jahr 1951 Überdosen von Heroin, Sedormid und Morphin verabreicht zu haben, die ihren Tod herbeigeführt hatten. Die alte und gutmütige Edith Morell hatte ihrem Arzt einen Rolls Royce und eine wertvolle Silberschatulle in ihrem Testament vermacht. Sechs Jahre später wurde Dr. Adams unter Mordanklage gestellt. Dazu kamen im Laufe der Untersuchungen 15 weitere Anklagepunkte, die von gefälschten Unterschriften bis zu Verstößen gegen das Giftgesetz reichten.
Außerdem wurden die Umstände, die zum Tod mehrerer anderer Patientinnen von Dr. Adams geführt hatten, genau überprüft. Dr. Adams, den die Zeitungen den „Witwenmörder von Eastbourne" nannten, bekannte sich in 14 Punkten der Anklage für schuldig, bestritt jedoch, den Tod der alten Dame herbeigeführt zu haben.
Adams wurde in einem abgetrennten Verfahren des Rezeptbetrugs in 13 Fällen schuldig gesprochen. Weitere Anklagepunkte waren Manipulation von Krematoriumspapieren, Fehlen eines Drogenverzeichnisses und Behinderung einer polizeilichen Durchsuchung. Er wurde von der Mordanklage freigesprochen, jedoch wegen der anderen Delikte zu 2400 Pfund Geldstrafe verurteilt. Außerdem wurden ihm für vier Jahre seine Zulassung als Arzt und die Berechtigung abgesprochen, seine Praxis weiter auszuüben.
Beides wurde ihm jedoch erst 1962, fünf Jahre nach dem Urteil, wieder zuerkannt. Nachdem er seine Zulassung zurückerhalten hatte, praktizierte er wieder als Hausarzt in Eastbourne. Als er 1962 ein Visum für die USA beantragte, wurde ihm dies verwehrt, weil er wegen seines Umgangs mit gefährlichen Drogen verurteilt worden war.
In späteren Jahren war er Präsident der britischen Tontaubenschützenvereinigung. Am 30. Juni 1983 brach er sich beim Schießtraining in Battle die Hüfte und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo er an einer Lungenentzündung am 4. Juli 1983 starb.
Er hinterließ ein Haus im Wert von 402.970 £ und ein Vermögen von 1.000 £. Dies hinterließ er Percy Hoskins, dem einzigen Reporter, der ihn während seines Mordprozesses unterstützt hatte. Dieser spendete das Geld karitativen Zwecken. Bis zuletzt wurde Adams in Testamenten seiner Patienten bedacht.
1986 behandelte der englische Spielfilm Der gute Doktor Bodkin seinen Fall. Die Hauptrolle spielteTimothy West.
Die Akten des Falles sollten zunächst bis 2033 unter Verschluss gehalten werden, wurden aber aufgrund einer Ausnahmegenehmigung bereits 2003 wieder veröffentlicht.
Quellen: Verbrecher von A-Z (Hubert Gundolf) Ausgabe 1966 – Seite 16 – wikipedia - sowie Bildergänzungen aus dem Archiv
9. Der Fall - Fäustlmörder Alfred Engleder
Noch heute, 46 Jahre nach der Verurteilung Alfred Engleders, ist der Fäustlmörder vielen Menschen im Raum Steyr ein Begriff, wissen die Leute schaurige Einzelheiten über die Taten der "Bestie".
Der 10. November 1955 ist ein nebeliger Spätherbstabend. Es nieselt leicht. Alfred Engleder ist mit seinem schwarzen Fahrrad zwischen Steyr und Sierning unterwegs. Er kocht vor Wut, ist wild entschlossen, in dieser Nacht einer Frau Gewalt anzutun. Bereits vier Tage zuvor überfiel er Gertrude Brunner. Die 24-Jährige wehrte sich so heftig, dass er von ihr ablassen musste - ein ähnliches Missgeschick soll heute nicht passieren.
Zeit seines Lebens fühlte sich der kleine Mann (1,58 m) von Frauen hintergangen und betrogen. Von seiner ersten Frau ließ sich Engleder scheiden. Als Grund gab er "Misshandlung" an. Die zweite Ehe ging er nur ein, weil schon ein Kind im Anmarsch war. Der gebürtige Sierninger (1920) hasst die Frauen und kennt nur ein Verlangen: sie zu erniedrigen. 1951 wird Elfriede Kranawetter sein erstes Opfer.
Vier Jahre später ist Margarete Fluch gerade auf dem Heimweg. Sie arbeitet als Krankenschwester im Steyrer Spital, wird von Kollegen und Patienten Schwester Bernhardine gerufen. Engleder entdeckt die junge Frau und zögert nicht lange. Er fährt dicht an sein Opfer heran und schlägt ihr das Fäustl auf den Kopf. Den leblosen Körper zerrt Engleder mit Mühe in ein Gebüsch. Die vorbeifahrenden Autos stören ihn nicht. Als Fluch zu Bewusstsein kommt, bittet sie ihren Peiniger um Hilfe. Der Frauenmörder kennt kein Erbarmen, knebelt sein Opfer und schlägt es halb tot. Fluch stirbt Stunden später an ihren schweren Verletzungen.
Nicht Alfred Engleder, sondern der Arzt Günther H. wird fälschlicherweise mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht - er hatte ein Verhältnis mit der Krankenschwester.
Zwei Jahre später begeht Engleder einen Fehler. Als er Herta Spann zum Beischlaf zwingen will, überrascht ihn ein Motorradfahrer. Er lässt sein Fahrrad und seine Uhr am Tatort zurück - Engleder wird überführt. 200 Gendarmen suchen nach "der Bestie von Steyr". Der Serientäter flüchtet.
Die anfangs erfolglose Suchaktion dient Jahre später dem Kabarettisten Helmut Qualtinger als Vorlage für "Unternehmen Kornmandl". An der tschechischen Grenze stellt ein Förster den Unhold. Alfred Engleder wird 1958 in Steyr der Prozess gemacht - "lebenslang" lautet das Urteil.
Nach 26 Jahren kommt Engleder frei. 1993 attackiert ihn seine Freundin Sonja Pyrchalla (26) mit einem Messer. Engleder (73) überlebt nur wenige Tage. In seiner kranken Phantasie wollte Alfred Engleder immer etwas Besonderes sein. Das ist gelungen. Heute noch reden die Leute über den "Mörder mit dem Maurerfäustl".
Quellen: - OÖNachrichten vom 14.02.2004 (von Martin Dunst)